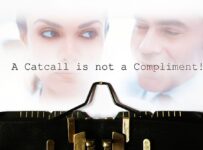Von Kave Atefie
Amerika hat ein Drogenproblem. Genauer gesagt: ein gewaltiges, historisch gewachsenes, wirtschaftlich befeuertes, kulturell verankertes und politisch befehligtes Drogenproblem.
Und ja, Donald J. Trump, der 45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten, steht exemplarisch für eine zynische Ausnutzung der Krise zu politischen Zwecken.
Die von ihm aktuell in den medialen Fokus gebrachte Fentanyl-Krise ist aber nicht der Anfang – es ist bloß die letzte Eskalationsstufe eines nationalen Drogenproblems, das längst außer Kontrolle geraten ist.
Das synthetische Opioid Fentanyl ist quasi nur das jüngste Symptom einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten im Delirium dahintaumelt.
Tatsächlich wird die Debatte um Opioide, illegale Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente oft so geführt, als hätte der massenhafte Konsum in den USA keinen spezifischen Hintergrund.
Dabei erzählt er viel über eine Gesellschaft, die sich selbst in einem permanenten Leistungsrausch gefangen hält.
Trump ist aktuell der letzte Anführer einer systemischen Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Ideologie in den USA, aber das Phänomen reicht tiefer.
Nixon, Reagan, Clinton, Bush – sie alle haben die Strukturen mitverantwortet: fehlende Regulierung von Pharmaunternehmen, Subventionen für Fast Food, destruktive Sozialpolitik und nicht zuletzt ein repressiver Umgang mit Konsumenten durch den „War on Drugs“, der eher kriminalisiert als hilft.
Eine Nation im Rausch
Um zu verstehen, warum die Vereinigten Staaten auf eine solche Katastrophe zusteuern konnten, muss man tief graben.
Die Geschichte des Drogenkonsums in Amerika beginnt nicht mit Oxycodon (ein starkes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide).
Schon im 19. Jahrhundert waren Morphin und Laudanum weit verbreitet, insbesondere unter Frauen der oberen Gesellschaftsschichten.
Später kamen Heroin und Kokain hinzu, teils frei erhältlich in Apotheken.
Mit der Prohibition (1920–1933) wurde Alkohol zwar verboten, aber paradoxerweise stieg der Konsum in der Zeit an. Die Botschaft: Wer etwas wirklich will, besorgt es sich.
Diese Haltung – gepaart mit einer Kultur des Individualismus und einem von Medien und Werbung geschürten Selbstoptimierungswahn – ist ein idealer Nährboden für Drogenmissbrauch.
Geschichtlich betrachtet könnte man Wagemut, Gewalt und Gottesfurcht als jene drei Säulen bezeichnen, auf denen das moderne Amerika basiert.
Zudem kommt der unerschütterliche Glaube an den amerikanischen Traum, an den Aufstieg aus eigener Kraft.
Ein Anspruch, an dem viele scheitern müssen – und mit dem Scheitern beginnt oft der Griff zur Flasche, zur Pille, zur Spritze.
Hinzu kommt eine von frühester Kindheit an internalisierte Leistungsideologie.
Schon in der Schule werden Kinder mit Wettbewerben, Noten und Zielvereinbarungen konfrontiert. Wer nicht mithält, wird schnell als Versager abgestempelt.
Für viele junge Menschen entsteht daraus eine psychische Überforderung, die später durch Substanzen kompensiert wird.
In dieser Umgebung gedeiht die Vorstellung, dass jede Schwäche pharmakologisch regulierbar ist: Ritalin für die Konzentration, Xanax gegen die Angst, Adderall für die Karriere.
Biochemie der Abhängigkeit
Seit dem zweiten Amtsantritt von Donals Trump ist Fentanyl als Teil der Opioid-Krise in den USA ins Rampenlicht gerückt worden.
Fentanyl ist eigentlich bereits in den frühen 1960er Jahren aufgekommen – damals wurde das Medikament gegen starke Schmerzen von Ärzten über die Vene verabreicht.
Die Substanz gehört, wie Morphium, zu den Opioiden, wird allerdings synthetisch, also ausschließlich künstlich im Labor hergestellt.
Heute steht der Wirkstoff auch als Hautpflaster oder als Lutschtablette zur Verfügung.
Und warum sind Opioide so gefährlich? Die Antwort liegt im Gehirn. Opioide binden an spezifische Rezeptoren und schütten Dopamin aus, das Glückshormon.
Es entsteht ein Gefühl tiefer Entspannung, Euphorie, Schmerzfreiheit.
Doch das Hirn gewöhnt sich schnell an diesen Zustand. Die natürliche Produktion von Dopamin fällt ab, das Belohnungssystem wird umprogrammiert.
Der Konsument braucht immer mehr, um denselben Effekt zu erzielen. Entzug bedeutet nicht nur körperliche Qual, sondern auch emotionale Leere.
Langfristig verändert chronischer Drogenkonsum die Architektur des Gehirns. Insbesondere das limbische System – zuständig für Emotionen, Motivation und Triebe – wird dauerhaft geschädigt.
Die frontale Hirnrinde, verantwortlich für Entscheidungsfindung und Impulskontrolle, verliert an Funktion.
Betroffene verfallen in zwanghafte Verhaltensmuster, ihr gesamtes Denken kreist um die nächste Dosis. Der Körper verliert die Fähigkeit zur natürlichen Schmerzregulierung und Selbstberuhigung.
Zudem spielen genetische Faktoren eine Rolle: Menschen mit bestimmten Genvarianten reagieren empfindlicher auf die belohnenden Effekte von Opioiden.
Auch psychische Vorerkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen erhöhen zudem das Risiko einer Suchtentwicklung.
Diese biochemischen Zusammenhänge machen deutlich: Sucht ist eine Krankheit – keine Charakterschwäche.
Die Industrie der Sucht
Purdue Pharma und die Familie Sackler stehen sinnbildlich für das Übel. Sie vermarkteten OxyContin ab Mitte der 1990er aggressiv als „nicht suchterzeugend“. Ärzte wurden mit Geschenken und Konferenzen überflutet, Patienten mit Rezepten.
Das Ergebnis: ein Millionenheer an Abhängigen und Tote. Die Sacklers wurden reich, Purdue wurde verklagt, aber die strukturelle Verantwortung wurde kaum hinterfragt.
Das Problem ist tiefer: Die amerikanische Gesellschaft produziert Sucht in Serie. Appetitzügler, Antidepressiva, Schlafmittel, Benzodiazepine – das Sortiment der Psychohilfen ist breit.
Rund 11% der US-Bevölkerung nimmt regelmäßig Antidepressiva.
Viele dieser Mittel werden zu schnell, zu oft, zu lang verschrieben. Nicht weil Patienten danach fragen, sondern weil das System es hergibt. Medikamentenmissbrauch ist kein Einzelfall, sondern eine Folge industriell optimierter Gesundheitsversorgung.
Dahinter steckt ein milliardenschweres Geschäftsmodell. Big Pharma unterhält ganze Netzwerke aus Pharmavertretern, Lobbyisten, Marketingagenturen und Ärztenetzwerken. Rezeptzahlen werden incentiviert, Nebenwirkungen heruntergespielt, Langzeitstudien gezielt verzögert oder geschönt.
Zudem steht die Food and Drug Administration (FDA), eigentlich als Kontrollinstanz vorgesehen, unter dem Druck von Industrieinteressen und leidet an chronischer Unterfinanzierung. In diesem Klima gedeiht eine Ökonomie der Abhängigkeit – staatlich reguliert, privat monetarisiert.
Alkohol: Der blinde Fleck
Während Drogenkriege geführt und Drogensüchtige kriminalisiert werden, bleibt Alkohol – die Volksdroge Nummer eins – weitgehend unantastbar.
Dabei ist Alkohol für mehr Todesfälle, Verkehrsunfälle, familiäre Gewalt und Arbeitsausfälle verantwortlich als viele andere Substanzen zusammen.
Er ist allerdings kulturell akzeptiert, gesellschaftlich eingebettet und wirtschaftlich hochprofitabel.
Wenn Charles Bukowski heute noch leben würde, hätte er vielleicht gesagt:
„Man muss nicht total besoffen sein, um klar zu sehen: Amerika hat auch ein Alkoholproblem.“
Der Konsum beginnt früh, die Langzeitfolgen sind bekannt – doch die Regulierung ist halbherzig. Eine Doppelmoral, die das Gesamtausmaß des Problems verschleiert.
High mit Stil: Popkultur und Drogen
Drogen sind außerdem auch ein kulturelles Phänomen. Autoren wie Jack Kerouac, William S. Burroughs oder Charles Bukowski lebten ihre Exzesse offen aus.
Musiker wie Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Kurt Cobain wurden zu Ikonen eines Lebens am Limit. Der bekannte amerikanische Psychologe und Autor Timothy Leary, propagierte LSD zur Bewusstseinserweiterung.
Die amerikanische Gegenkultur feierte den Rausch förmlich als Protest gegen Normen und Spießigkeit.
Doch was in der Popkultur romantisiert wird, fordert in der Realität ihren Preis.
Drogen als Rebellion oder Lifestyle funktionieren nur so lange, wie man sich die Folgen leisten kann – viele können das nicht.
Die politische Komponente der Krise
Suchtverhalten entsteht nicht im luftleeren Raum – es hat immer auch eine politische Dimension.
In der Geschichte der Vereinigten Staaten haben sich gesellschaftliche Umbrüche, wirtschaftliche Notlagen und politische Traumata regelmäßig in einem erhöhten Konsumverhalten niedergeschlagen.
Die erste große Welle von Morphinabhängigkeit fiel mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg zusammen. Verwundete Soldaten wurden massenhaft mit Opiaten behandelt – nicht selten mit lebenslanger Folgeabhängigkeit.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Heroinkonsum unter Kriegsveteranen zum Problem.
Ähnliches wiederholte sich nach Vietnam: Viele US-Soldaten kehrten traumatisiert und mit Heroingewohnheiten zurück.
Auch der Irak- und Afghanistan-Einsatz hat zu einer Veteranengeneration geführt, die durch Schmerzmittel, Traumata und chronische Überforderung in Abhängigkeit rutschte.
Ein weiterer Faktor: Einwanderung und struktureller Rassismus.
Schon früh wurden Drogen in rassistisch gefärbten Diskursen kriminalisiert – Opium mit Chinesen, Marihuana mit Mexikanern, Crack mit Afroamerikanern. Statt Hilfe dominierte Repression. Ganze Generationen wurden durch den „War on Drugs“ entrechtet, insbesondere schwarze Männer.
Das Resultat ist ein tiefes Misstrauen gegenüber staatlicher Gesundheitsversorgung in marginalisierten Communities – und eine gesteigerte Verwundbarkeit.
Auch jüngere Krisen spielen eine Rolle: Die Covid-19-Pandemie etwa verschärfte soziale Isolation, Arbeitslosigkeit und psychische Belastungen. Währenddessen stiegen Überdosiszahlen und Medikamentenverschreibungen dramatisch an.
In einer Nation ohne soziale Sicherheitsnetze kann jede Krise – ob wirtschaftlich, kriegerisch oder gesundheitlich – zur persönlichen Katastrophe werden. Und jede persönliche Katastrophe birgt die Versuchung der Betäubung.
Trump, Fentanyl und der politische Zynismus
Donald Trump nutzt die Fentanyl-Krise, um seine Agenda zu stützen. Er spricht von einem „vergifteten Krieg gegen Amerika“, fordert harte Grenzmaßnahmen gegen Mexiko und drakonische Strafen für Dealer. Dabei sind die meisten Opfer keine Straßendealer, sondern verzweifelte Konsumenten aus der weißen Mittelklasse.
In einem außenpolitischen Schachzug richtete Trump zuletzt auch den Blick auf Kanada. Er warf der dortigen Regierung vor, nicht entschieden genug gegen den Schmuggel von aus China stammendem Fentanyl vorzugehen, das über kanadisches Gebiet in die USA gelange.
Als Druckmittel brachte er Strafzölle ins Spiel – nicht auf Medikamente, sondern auf kanadische Aluminium- und Stahlimporte. Damit koppelte er die Drogenkrise direkt an wirtschaftliche Interessen und diplomatische Drohkulissen – ein kalkulierter Akt politischer Instrumentalisierung.
Trumps Rhetorik kaschiert systemisches Versagen. Seine Regierung schwächte Programme zur Suchtprävention, kürzte Mittel für psychische Gesundheit und setzte auf Abschreckung statt auf Hilfsangebote.
Gleichzeitig wurde Big Pharma weitgehend geschont – während der Öffentlichkeit das Bild eines drogenverseuchten Amerikas präsentiert wurde, das vor allem von außen unterwandert werde.
USA: Warum staatliche Gegenmaßnahmen versagen
Viele Bundesstaaten haben Klagen gegen Pharmakonzerne eingereicht, Programme zur Entgiftung aufgelegt oder Methadon ausgegeben. Doch die Krise ebbt nicht ab.
Warum? Weil sie nicht nur ein medizinisches, sondern ein soziales Problem ist. Ohne Wohnraum, Jobs, psychosoziale Betreuung bleibt jeder Ausstieg prekär. Die USA investieren Milliarden in Repression, aber wenig in Resilienz.
Auch das Gesundheitswesen ist Teil des Problems: In einem profitorientierten System ist ein kranker Patient ein zahlender Kunde. Prävention bringt keine Rendite.
Nahrung für die Sucht
Ein oft unterschätzter Faktor: Die Lebensmittelindustrie. Zucker, Fett, Salz – diese Kombination macht ebenfalls süchtig. Fast Food, Softdrinks, Snacks: Übergewicht, Diabetes, Herzkrankheiten und Depressionen sind die Folge.
Auch hier wirkt das Belohnungssystem im Gehirn, auch hier entsteht ein Kreislauf von Konsum und Leid. Die pharmazeutische Industrie profitiert doppelt: Sie stellt Medikamente für die Symptome und für die Folgekrankheiten.
Der Zusammenhang zwischen Ernährung, psychischer Gesundheit und Suchtverhalten ist inzwischen wissenschaftlich gut belegt.
Chronisch ungesunde Ernährung kann Entzündungsprozesse im Körper verstärken, die wiederum mit der Entstehung depressiver Symptome in Verbindung stehen.
Besonders stark verarbeitete Lebensmittel, sogenannte „ultra-processed foods“, stehen im Verdacht, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch krank zu machen. Sie manipulieren gezielt das Belohnungssystem im Gehirn – ähnlich wie Nikotin oder Kokain.
In sogenannten „Food Deserts“ – Stadtteilen, in denen es kaum Zugang zu frischen, gesunden Lebensmitteln gibt – ist die Abhängigkeit von Fertigprodukten besonders hoch.
Arme, marginalisierte Bevölkerungsschichten ernähren sich überproportional häufig von Billigprodukten, deren Nährwert gering, deren Suchtpotenzial aber hoch ist.
Die Kombination aus wirtschaftlicher Not, psychischer Belastung und schlechtem Essen wirkt wie ein Brandbeschleuniger für gesundheitlichen Verfall.
Die Lebensmittelindustrie arbeitet mit denselben Prinzipien wie Big Pharma: Gewinnmaximierung durch Konsumsteigerung. Werbung zielt schon auf Kinder ab, Verpackungsdesigns sind emotional codiert, die Produkte werden chemisch so abgestimmt, dass sie möglichst schwer verzichtbar sind.
Dabei sind nicht nur einzelne Firmen, sondern ein ganzes System beteiligt – unterstützt durch Subventionen, Lobbyismus und fehlende Regulierungen.
Der Körper wird damit schon früh auf einen ständigen Wechsel zwischen Reiz und Erschöpfung, zwischen Hochgefühl und Absturz konditioniert – eine biochemische Vorbereitung auf spätere Suchtmuster.
Wer von klein auf mit überzuckerten Frühstücksflocken aufwächst und später mit Energy Drinks, Chips und Antidepressiva durch den Tag kommt, lebt in einer Endlosschleife aus künstlich erzeugter Bedürftigkeit.
Diese Art von alltäglicher Selbstvergiftung bleibt meist unsichtbar – doch sie ist flächendeckend und systemisch.
Der Blick über den Tellerrand
Während die Vereinigten Staaten in einem Teufelskreis aus Strafverfolgung, Profitinteressen und Symptombehandlung gefangen sind, zeigen andere Länder, dass es auch anders geht.
Portugal etwa hat 2001 sämtliche Drogen entkriminalisiert – nicht legalisiert, sondern in den Bereich der öffentlichen Gesundheit verschoben. Statt Gefängnisstrafen erhalten Konsumenten dort Beratung, Zugang zu Therapie und soziale Unterstützung.
Das Ergebnis: Die Zahl der Drogentoten sank dramatisch, HIV-Neuinfektionen gingen zurück, die gesellschaftliche Stigmatisierung ließ nach.
Auch in Kanada experimentiert man mit sogenannten „Safer Supply“-Programmen, bei denen Abhängigen unter ärztlicher Aufsicht pharmazeutisch reines Heroin oder Fentanyl verabreicht wird – ein pragmatischer Ansatz, der Überdosierungen und Kriminalität verringern soll.
In der Schweiz gibt es ähnliche Modelle seit den 1990er Jahren mit messbarem Erfolg. Diese Beispiele zeigen: Der Umgang mit Drogen ist keine Frage der Härte, sondern der Haltung.
Schlussgedanken
Der amerikanische Weg ist ein Sonderweg – ein toxischer Cocktail aus Pioniermythos, Marktglauben und heuchlerischer Doppelmoral.
Die USA feiern den individuellen Aufstieg, kriminalisieren aber den individuellen Absturz.
Sie erlauben es der Wirtschaft, Süchte zu erzeugen, und bestrafen dann deren Symptome. Der Preis dafür sind Millionen zerstörter Leben.
Das klingt sehr hart, doch die Wahrheit über Amerikas Drogengesellschaft ist unbequem – wer Sucht nur als Randphänomen betrachtet, hat bereits verloren.
Drogen sind längst mitten in der Gesellschaft angekommen – verpackt, verkauft und tief verankert.
Dieser Wahrheit ins Auge zu blicken, wäre der erste Schritt aus der Ohnmacht und möglicherweise die Chance das Problem an den Wurzeln zu packen.
Ein solider gesellschaftlicher Konsens darüber ist allerdings weit und breit nicht auszumachen.
——-
Quellen:
¹ Die Opioidkrise der USA – Ausbruch und Entwicklung (Olivia Putz; vorwissenschaftliche Arbeit; GRG 19, Billrothstraße 73, 1190 Wien; Abgabedatum: 13.02.2025)*
² Understanding the Opioid Overdose Epidemic
³ Purdue Frederick pleads guilty in OxyContin case (REUTERS | abgefragt: 24.7.25)
– Brand, Jeff: The Opioid Epidemic as Collective Trauma: An Introduction to the Crisis. In: Group, Vol. 42, No. 4, 2018.
– Freye, Enno: Opioide in der Medizin. 8. Auflage. – Heidelberg: Springer, 2019.
– Meier, Barry: Pain Killer. An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epide-mic. ─ New York: Random House, 2023.
* Wir bedanken uns bei Olivia Putz für die Zurverfügungstellung Ihrer ausgezeichneten vorwissenschaftliche Arbeit im Rahmen ihrer Matura.
Linktipps:
Was hat Angst mit Heilung zu tun?
Rohstoff Cannabis – wie mit Hanf legal Millionen verdient werden
Rache, nicht Recht: Warum wir uns den falschen Strafvollzug leisten
Greifen leistungsorientierte Menschen öfter zu Medikamenten?
Schmerz lass nach: Erste Hilfe bei Rückenschmerzen